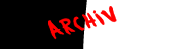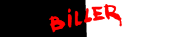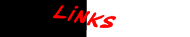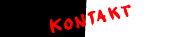Krise und Aufbruch der LSAP
Ein Positionspapier der Fondation Robert Krieps zur Sommerakademie der LSAP
Oktober 2014
„Alle große politische Aktion besteht im Aussprechen dessen, was ist,
und beginnt damit. Alle politische Kleingeisterei besteht
in dem Verschweigen und bemänteln dessen, was ist."
F. Lassalle
„Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel."
J. Jaurès
Die LSAP befindet sich unbestreitbar in einer Krise. Bei den Europawahlen vom 25. Mai 2014 hat die LSAP das schlechteste Wahlergebnis ihrer Geschichte seit 1945 eingefahren. Bereits bei den Kammerwahlen vom 20. Oktober 2013 hat sie zwar die Zahl ihrer Abgeordneten knapp halten können, aber ebenfalls deutlich an Wählerstimmen verloren. Die LSAP ist nicht mehr klar und eindeutig die zweitgrößte Partei des Landes, sondern ihr wird diese Rolle zurzeit von der DP streitig gemacht. Die Zeiten, als die LSAP in der Wählergunst fast auf Augenhöhe mit der CSV war (1964, 1984) sind vorbei. Aber jede Krise bietet auch die Möglichkeit eines Wendepunkts und Neuanfangs. Angesichts der schleichenden Stimmenverluste bei nationalen Wahlen und vor allem der letzten Europawahl steht die europäische Sozialdemokratie insgesamt und somit in Luxemburg auch die LSAP vor der Herausforderung, ihre Politik der letzten Jahre sorgfältig zu analysieren und mögliche Fehlentwicklungen klar zu benennen. Die LSAP muss sich inhaltlich und strukturell öffnen und eine zukunftsgerichtete und glaubwürdige programmatische Alternative zu einer konservativen und/oder marktgläubigen Politik zu entwickeln.
Entscheidend für zukünftige politische Erfolge ist die kohärente Gesamtaufstellung einer Partei: dies betrifft sowohl Grundwerte, Programm, Ethik, Regierungspolitik und Organisation, wie auch Mitgliederrekrutierung, Führung, Fraktion und Partei, kommunaler und nationaler Handlungsspielraum, Leistungsbilanz, Kommunikation nach innen und außen, Pressearbeit, gesellschaftliche Partnerschaften sowie Sozialpolitik, Europa- und Globalisierungsstrategie müssen ein stimmiges Gesamtbild ergeben. Jeder Einzelne ist gefordert: vom Regierungsmitglied bis zum einfachen Parteimitglied. Denn es gibt keine Patentlösung, kein „y-a-qu'à", keine eindimensionale Antwort oder Strategie, die kurzfristig wieder zum Erfolg führen könnte.
Auf Bitten der Parteileitung, möchte die Fondation Robert Krieps in diesem Papier jedoch einige Thesen strukturieren und zusammenfassen und verschiedene Gedanken zur Debatte stellen, die sich spezifisch auf den Luxemburger Kontext beziehen. Ziel dieses Papiers ist es, Meinungsäußerungen vieler einzelner Parteimitglieder vor und während der Sommerakademie zur Krise der LSAP zu strukturieren und durch einige Pisten die Richtung aufzuzeigen in die die LSAP sich weiterentwickeln könnte oder müsste, wenn sie in der Politiklandschaft Luxemburgs als linke Volkspartei zukunftsfähig sein will.1
Diese Thesen sollen die Diskussion über die Zukunft der LSAP anregen ohne jedoch den Anspruch zu erheben, die einzelnen Themengebieten in allen Details und erschöpfend zu behandeln. Auch wenn die für die LSAP missglückte Europawahl zum Teil Anlass für dieses Papier ist, so werden kontextspezifische Umstände und Fehler die in diesem Wahlkampf gemacht wurden nicht berücksichtigt: es gilt nur systemrelevant Missstände zu benennen und nach vorne zu blicken.
Die LSAP braucht einerseits eine klare Botschaft („message fort") und eine klare Richtschnur für ihre Politik und andererseits muss sie sich thematisch breit aufstellen. Es gilt dabei Mut zu eigenen parteipolitischen Positionen und Werten zu haben. Denn eine fortschrittliche Politik braucht Mut zur Veränderung und starke Überzeugungen! Linke Politik muss den Anspruch haben zu gestalten und nicht nur zu verwalten. Eine linke Volkspartei muss immer den Anspruch haben - und diesen dann auch vermitteln - die Gesellschaft in Richtung von mehr Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit zu verändern. Man sollte sich in diesem Rahmen daran erinnern, dass die demokratische Arbeiterbewegung, wenn sie mutig war, historisch in allen wichtigen Debatten der letzten hundert Jahre auf der richtigen Seite stand - für Demokratie und allgemeines Wahlrecht, für eine progressive Besteuerung und die Einführung von Sozialversicherungen (C.M. Spoo und Dr. Welter - bereits 1905 hatten die Sozialdemokraten dann auch eine Petition für das Frauenstimmrecht im Parlament eingereicht), für das Luxemburger Modell des Sozialstaats (vgl. Kollektivverträge 1936, die grundlegenden sozialstaatlichen Maßnahmen von Pierre Krier in der unmittelbaren Nachkriegszeit und später die Politik der sozialliberalen Koalition, Einführung der Tripartite), gegen Maulkorb und Faschismus, sowie auch gegen Kommunismus, klar für Europa und einen "modernen Rechtsstaat" (Robert Krieps), für individuelle, wie auch kollektive Grundrechte, für die Abschaffung der Todesstrafe, für die Emanzipation der Frau, mehr internationale Kooperation und Entwicklungshilfe (Lydie Schmit) und gegen alte und neue Diskriminierungen jeder Art - und dass sie auch heute wieder die Initiative ergreifen und die Diskurshoheit in grundsätzlichen und neuen Fragen wiedergewinnen muss.
Es waren vor allem Solidarität und soziale Gerechtigkeit, die den Schwachen zu mehr Freiheit verhalfen und somit einer steigenden Zahl von Menschen Freiheit real erfahrbar machten. Es gilt auch jetzt wieder dafür zu sorgen, dass die großen gesellschaftlichen Lebensbereiche von den Grundwerten der Demokratie und der Gerechtigkeit durchdrungen werden. Auch in Luxemburg geht es für die LSAP darum, dass eine fortschrittliche Politik der sozialen Gerechtigkeit in Verbindung mit wirtschaftlicher und ökologischer Innovation entwickelt und umgesetzt wird.
* * *
In einem ersten Teil (1) dieses Papiers wird eine allgemeine Analyse über die heutigen Probleme der LSAP und der europäischen Sozialdemokratie in sechs Schwerpunkten angestrebt. In einem zweiten Teil (2) wird kurz auf die letzten 12 Monate eingegangen und in einem dritten Teil (3) wird die Frage gestellt, was es jetzt konkret auf den drei Ebenen der (a) Programmatik, (b) der Parteiorganisation und der (c) Kommunikation zu tun gilt. In einem Fazit (4) werden unter anderem auch einige Prioritäten genannt, zu deren Umsetzung die Parteileitung sich konkret innerhalb eines Jahres verpflichten sollte.
1. Allgemeine Analyse - Probleme der LSAP und der Sozialdemokratie heute
Angesichts der dramatischen Verluste bei Wahlen steht die LSAP vor der Herausforderung, ihre Politik der letzten Jahrzehnte im Detail zu analysieren. Der allgemeine Abwärtstrend zeigt dabei, dass sowohl individuelle länderspezifischen Gründe, als auch länderübergreifende, gesellschaftspolitische Veränderungen eine gewichtige Rolle spielen. Die Analyse, weshalb dem so ist, bedarf zunächst einer Bestandsaufnahme auf verschiedenen Ebenen. Die verschiedenen Erklärungsebenen können im Einklang mit der Diskussion auf nationaler und europäischer Ebene sechs Thesen zugeordnet werden, die teilweise miteinander in Verbindung stehen:
Soziologische Veränderung: Die soziologischen Entwicklungen der letzten drei Jahrzehnte haben zwei, eng miteinander verbundene, Konsequenzen für die Sozialdemokratie. Einerseits, so meinte zumindest der deutsch-britische Soziologe, Politiker und Publizist Ralf Dahrendorf bereits 1983, habe mit dem Ende des Industriezeitalters die Sozialdemokratie ihre Aufgabe erfüllt und sei somit überflüssig geworden. Die Wählerbasis einer unterdrückten und entrechteten Industriearbeitnehmerschaft gäbe es nicht mehr. Das politische Versprechen des sozialen Aufstiegs wurde entweder zum Teil bereits erfüllt oder wird als nicht mehr glaubwürdig angesehen (Dahrendorf-These 1983). Die sozialdemokratischen Parteien haben sich von ihrer Ursprungsbasis, der Arbeitnehmerschaft, entfremdet. Exklusive Verbindungen zu Gewerkschaften bzw. sozialen Bewegungen bestehen nicht mehr bzw. haben in den letzten Jahren abgenommen. Die inhaltlichen Angebote sozialdemokratischer Parteien korrespondieren nicht mehr mit den Vorstellungen und Problemen der Arbeitnehmerschaft, die zunehmend keine individuellen Aufstiegschancen mehr sieht. Andererseits, ist, in einer Gesellschaft, in der der Dienstleistungsbereich neue Schichten von hoch- und mittelqualifizierten Arbeitnehmern benötigt, der Industriebereich jedoch abnimmt und die Arbeiterschaft in hohem Masse aus Nichtwählern besteht, eine große Anzahl von Luxemburger Wählerinnen und Wählern im geschützten Bereich arbeiten (Staat, Gemeinden, konventionelle Bereiche, öffentlich subventionierte Bereiche) oder bereits in Rente sind, die LSAP als angebliche „Arbeiterpartei" für manche dieser (auch ehemaligen) Arbeitnehmer nicht mehr erste Wahl. Inhaltlich gibt die LSAP sich als Hauptkompetenz die Verteidigung und den Ausbau des Sozialstaates. Sie wird zudem von verschiedenen Seiten - auch durch manche Leitartikel in der Presse - entweder als schwach und nicht sozial genug wahrgenommen und dargestellt oder aber immer wieder als verlängerter Arm der freien Gewerkschaften angesehen (politischer Druck).
Einengungsthese: Der Raum zur programmatischen Positionierung im Parteienspektrum wird für sozialdemokratische Parteien eingeengt. Sei es, dass die konservativen Parteien »sozialer« geworden sind und immer mehr die politische Mitte besetzen, oder dass linkspopulistische Parteien die Stimmen der unzufriedenen Bevölkerungsschichten an sich ziehen. Einerseits werden Wahlen in Luxemburg vor allem in der Mitte gewonnen, andererseits muss die LSAP ihr Profil als linke Volkspartei schärfen. Die LSAP erhält dabei zunehmend Konkurrenz sowohl links, als auch in der Mitte: „déi Lenk" ist eine starke Konkurrenz bei den Gewerkschaften (im Landesverband sind Linke tonangebend; im OGB-L zum Teil ebenfalls); die Grünen vertreten verschiedentlich ebenfalls linke Thesen, besonders in gesellschaftspolitischer Hinsicht; die CSV hat - auch ohne Juncker - immer noch einen christlich-gewerkschaftlichen Flügel. Andererseits besetzt die DP die politische Mitte mit ihrem Pragmatismus und dem Anspruch auf vermeintliche wirtschafts- und finanzpolitische Kompetenz.
Diskurshoheitsthese: Sozialdemokratische Parteien haben zum Teil die Diskurshoheit über wichtige gesellschaftliche Themen verloren. Oft wird auf wichtige Themen nur reagiert, anstatt Themen zu besetzen und die Debatte zu bestimmen. Sicher ist, dass die ersten Jahre im neuen Jahrtausend neue Herausforderungen an die Parteien gestellt haben, mit denen einige Parteien besser, andere weniger gut umgehen konnten. Unter letzteren befanden sich vor allem die Regierungsparteien. Zu Beginn der Legislatur 2004 bis 2009 zeigten sich die Herausforderungen immer klarer, die dann mit der Finanz- und der darauf folgenden Wirtschaftskrise auch Luxemburg beschäftigten. Dabei vertrat die Regierung eine vermeintlich „fiskal-konservative" Politik, die eine Konsolidierung der Staatsfinanzen betrieb, ohne jedoch den Sozialstaat abzubauen. In einer Zeit, in der die Einnahmen des Staates abnahmen, konnte weniger verteilt werden. Des Weiteren stagnierten die Einkommen der Lohnempfänger - auf einem relativ hohen Niveau - was aber zur Unzufriedenheit sowohl der Gewerkschaften und Arbeitnehmer (Stagnation), als auch der Wirtschaftsverbände, die ihrerseits immer wieder über zu hohe Lohnkosten klagten, führte. Bei gesellschaftlichen Reformen machen DP und Grüne der LSAP starke Konkurrenz und die LSAP kann Erfolge einer fortschrittlichen Politik nicht für sich selbst verbuchen (Abtreibung, Homoehe etc.). In der neuen Legislatur ist die LSAP weiterhin im Krisenmanagement und in der Weiterentwicklung des Wirtschafts- und Sozialmodells mit zwei neuen Partnern eingebunden, hat also wiederum nicht die Zeit, sich selbst inhaltlich und politisch in Frage zu stellen.
Unglaubwürdigkeits-/Leistungsbilanz-These: Sozialdemokratische Parteien werden nicht mehr durchgehend als verlässliche Garanten für soziale Gerechtigkeit angesehen. Die auch von Sozialdemokraten durchgesetzten Reformen in den letzten Jahren werden zum Teil als sozial ungerecht empfunden (z.B. in Deutschland die viel - und teilweise zu Recht - kritisierte Agenda 2010 unter Gerhard Schröder). Die Leistungsbilanz sozialdemokratischer Regierungsbeteiligung wird von der klassischen Wählerschaft als enttäuschend eingeschätzt. Geschichtlich gesehen ist die LSAP erstmals 1937 in eine Regierung eingetreten. Sie blieb in Regierungsverantwortung bis 1947, dann wieder von 1951 bis 1959, 1964 bis 1968, 1974 bis 1979, 1984 bis 1999, 2004 bis 2013. Außer der Mittelinkskoalition von 1974 bis 1979 war ihr Koalitionspartner immer die CSV, weil sie eben mit dieser Partei den Ausbau des Sozialstaates weitertreiben konnte. Die lange Koalitionszeit und die kurzzeitige Opposition verhinderten tief greifende Überlegungen über die langfristige theoretische und programmatische Ausrichtung der Partei. Zwischen dem programmatischen Anspruch (Tradition und allgemeine Grundwerte, „Neuanfang 2013") und der Regierungspolitik klafft immer eine Lücke. Hinzu kommt, dass das leitende politische Personal in der Hauptsache auf die Machtausübung fixiert und zu Kompromissen bereit war, die die LSAP immer mehr zur (linken) Mitte trugen. Die Regierungsbeteiligung der LSAP wird von einem Teil der Wähler als ein bloßes „Am-Sessel-kleben" interpretiert, das zum alleinigen Zweck hat, dass die Regierungsmitglieder weiterhin die üblichen Ministerprivilegien genießen können. Wenn LSAP-Politiker, in der Wahrnehmung der Wähler, als egoistisch oder hedonistisch und mehr dem Eigeninteresse als dem Allgemeinwohl verpflichtet angesehen werden, so beschädigt dies den Ruf der LSAP als Partei "des kleinen Mannes" und der sozialen Gerechtigkeit auf das Schwerste.
Spaltung-der-Wählerbasis: Die einstige Wählerbasis der Sozialdemokraten hat sich in Globalisierungsbefürworter und -gegner gespalten. Wähler, die in einer globalisierten Welt mit einer europäischen Wissensgesellschaft zu den Verlieren gehören oder sich gar in ihrem sozialen Status durch die Globalisierung bedroht sehen, fühlen sich durch die Sozialdemokratie nicht ausreichend vertreten und geschützt. Dies gilt vor allem bei Themen die weit in die Gesellschaft hineinreichen und in den sozialen Medien diskutiert werden. Der Bolkestein-Entwurf zur Dienstleistungsrichtlinie ist ein Beispiel. Das geplante Freihandelsabkommen mit den USA (TTIP) ein anderes. Letzteres wurde im Europawahlkampf bei vielen linken Wählern mehr als Angriff auf die Demokratie und auf europäische Sozial- und Umweltstandards, statt als Handelspartnerschaft mit wirtschaftlichem Potenzial gesehen. Auch wenn die Position der LSAP mit der der Grünen fast deckungsgleich war, konnte die LSAP ihre differenzierte Position im politischen Diskurs nicht geltend machen. Doch auch Globalisierungsbefürworter fühlen sich durch andere Parteien (DP), die z. B. die Interessen von gut ausgebildeten Eliten vertreten, besser repräsentiert. Die fortschreitende Individualisierung in den europäischen Gesellschaften begünstigt dabei zusätzlich die Herausbildung bzw. Stärkung von "spezialisierten" Kleinparteien (ADR, Piraten).
Wertewandelthese: Diese These betrifft die Ebene der Mentalitäten und persönlichen Einstellungen. In einer Zeit des Individualismus, in der ein jeder seine eigenen Ansprüche auf Selbstverwirklichung und ein gutes, voll ausgekostetes Leben verteidigt, ist politisches Engagement mit der kollektiven Komponente, wie sie die Parteiarbeit seit jeher in der LSAP voraussetzt , nicht mehr vorhanden. In den letzten Jahren haben zudem soziokulturelle Fragestellungen in der Problemhierarchie der Bevölkerung an Bedeutung gewonnen. Dabei artikulieren sich gesellschaftliche Wandlungsprozesse in der Folge der individualistischen Entwicklung und des individuellen Glücksversprechens der Post-68-Ära ebenso, wie die Folgen von Zuwanderung, die zu einer steigenden kulturellen, sozialen und religiösen Heterogenität der westeuropäischen Gesellschaften geführt hat. Teile der sozialdemokratischen Stammwählerschaft empfinden diese Veränderungen als Identitätsverlust. Die Abwanderung von ehemaligen Wählern der LSAP gerade aus Arbeitnehmermilieus in die Enthaltung oder zu populistischen Bewegungen (ADR oder Déi Lénk) ist die Folge. Konservativ geprägte Wähler bleiben jedoch aus soziologischen, religiösen oder opportunistischen Gründen immer noch bei der nur wenig schwächer gewordenen CSV.
2. Die letzten 12 Monate - Große Erwartungen... erste Enttäuschungen
Die vorzeitige Aufkündigung der Regierungskoalition mit der CSV im Juli 2013 war ein Schachzug, um „die Möbel zu retten" und einer sich andeutenden Wahlniederlage nach Ablauf der ganzen Mandatsperiode zu entgehen. Natürlich hat die LSAP es auch in der letzten Koalition - im Gegensatz zur CSV - geschafft wichtige Reformimpulse zu geben: eine solidarische und aktive Außenpolitik (Luxemburg als Mitglied des Weltsicherheitsrates), eine sozial gerechte Renten- und Gesundheitsreform, eine moderne Schulreform, eine effiziente Reform der ADEM, eine diskursive Landwirtschaftspolitik und eine moderne und dynamische Wirtschaftspolitik. Doch in den Koalitionsverhandlungen Ende 2013 schien es, als ob persönliche Vorlieben oder Ansprüche und die Bequemheit des Altbekannten den Vorrang vor einer grundlegenden Strategie gehabt hätten. Bereits die Verhandlungsgruppe (u.a. ohne Frau) wurde von vielen Wählern, als dem Neuanfang nicht entsprechend, angesehen. Im Resultat hat die LSAP (als knapp größte Partei der Koalition) keine der ausgeprägten Gestaltungsministerien wie beispielsweise Finanzen, Justiz, Logement, Schule, Forschung und Kultur mit denen sich vornehmlich progressistische Politik gestalten, umsetzen und kommunizieren lässt. Das Innen- sowie das Tourismusministerium und der damalige Ausblick auf einen Kommissionsposten sind nur ein schwacher Trost. Nachdem die LSAP in der vergangen Legislaturperiode federführend eine ganze Reihe von Reformen in ihren Ministerien umgesetzt hat, ist durch die Auswahl der Ministerien in der aktuellen Regierung, die Chance verpasst worden, die grundlegenden Reformbestrebungen der LSAP nun auch auf anderen Gebieten verstärkt zu bewerkstelligen.
In einer Koalitionsregierung zu dritt hat jede Partei im Prinzip "ihre" Ministerien, für die sie verantwortlich ist. Doch die LSAP muss sich als Partei trotzdem breiter aufstellen um alle politischen Bereiche abzudecken. Daher ist es wichtig Meinungen und Positionen in der Partei und Fraktion und in den Arbeitsgruppen zu entwickeln und nach außen zu tragen - und dies gerade weil die LSAP eher technische Ressorts hat und die Gestaltungs- oder Reformministerien von Grünen und DP besetzt sind: Budget, Steuern (Gramegna), Plans sectoriels (Bausch), Justiz und gesellschaftliche Debatten (Braz), Bildung, Innovation, Forschung, Kultur (Meisch, Nagel), Logement (Nagel), Sozialtransfers, Familie (Cahen), Umwelt (Dieschbourg). Dieses Ungleichgewicht darf die LSAP jedoch nicht ins Abseits setzen, sondern ihr als Partei neue Möglichkeiten der Reflexion und Kommunikation eröffnen.
Die LSAP muss eigene Initiativen und Lösungsvorschläge als Partei und auf parlamentarischer Ebene entwickeln, zum Teil auch mit externen Experten in den internen Arbeitsgruppen. Dies ist unserer Meinung nach eine der größten Herausforderungen für die LSAP in dieser Legislaturperiode. Um diese Herausforderung zu meistern, muss mehr denn je die Kommunikation zwischen Regierungsmitgliedern, Fraktion, Parteileitung und Parteimitgliedern ausgebaut werden. Eine größtmögliche Menge an Informationen zu allen Themen, die in der Regierung zirkulieren, muss in den verschiedenen Gremien der Partei diskutiert werden können. Die Partei braucht gleichzeitig eine klare Strategie, um der Kritik von Déi Lénk zu begegnen (die bei jeder Wahl auf Kosten der LSAP zumindest ein Prozent hinzugewinnen), sowie Angriffe aus der Zivilgesellschaft von links und rechts bei empfindlichen Themen zu kontern: durch Beschlüsse, parlamentarische Anfragen aber auch über die Presse und gezielt und systematisch in den sozialen Medien (facebook, Leserkommentare auf rtl.lu oder wort.lu).
3. Was kann man tun? - Politikgestaltung, Parteireform und Kommunikation
Was also tun? Welche Ziele soll die LSAP sich geben? Wenn auch das ultimative Ziel ist, elektoral stärker zu werden, um die Geschicke des Landes (mitzu)bestimmen, d.h. um Regierungsverantwortung zu übernehmen, kann dieses Ziel nicht das alleinige sein. Denn Politik ist mehr als Minister-, Abgeordnete- oder Gemeindeämter auszuüben. Politik machen heißt eine gesellschaftliche Rolle zu übernehmen, programmatische Inhalte zu entwickeln und die Menschen hiervon zu überzeugen. Die LSAP muss auf die Bevölkerung zugehen, die Probleme der Menschen ernst nehmen und eigene Ideen entwickeln. Die konkreten Anliegen der Jugend müssen Gehör finden und besonders auch junge Frauen und Mütter müssen sich im Programm der LSAP wieder finden können. In den letzten Jahren hat die Arbeit an (neuen) politischen Inhalten innerhalb der Partei stark gelitten. Arbeitskreise funktionieren kaum, und wenn es sie gibt, dann als Austausch unter einigen wenigen spezialisierten Parteimitgliedern, Abgeordneten und Minister. Die besten Köpfe gehen meist ganz in der Regierungs- und der Kammerarbeit sowie in der Gemeindearbeit auf. Die LSAP muss sich um Denkarbeit neben der tagtäglichen Politikbetätigung bemühen. Die Fondation Robert Krieps kann dafür eingespannt werden, hat allerdings wenig Mittel, wenn es heißt, in- und ausländische Spezialisten einzuladen.
a. Programmatische Inhalte - eine klare und kohärente politische Ausrichtung
Neben den eher strukturellen und formalen Aspekten stellen sich für die LSAP heute vor allem inhaltliche Fragen. Seit dem stimmig geführten Wahlkampf von 1984, hat die LSAP fast ausschließlich Verluste bei nationalen Wahlen erlitten. Die LSAP erschien in den letzten Jahren bei der Besetzung von politischen Sachthemen, mit einigen wichtigen gesellschaftspolitischen Ausnahmen, oft eher als Getriebene ("Die Partei des kleineren Übels"), die es nicht geschafft hat längerfristig die politische Agenda zu bestimmen und damit eine klare Identität nach außen zu entwickeln oder wieder herzustellen. Hohe persönliche Umfragewerte einiger weniger Mandatsträger können auch im Luxemburger Wahlsystem keine klare Identität der Partei ersetzen. Jahrzehntelang haben die sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien in Europa den Sozialstaat aufgebaut. Dessen Finanzierbarkeit wird jedoch immer schwieriger, mit der Konsequenz, dass besagte Parteien in ihrem Kernthema, der Sozialpolitik, in die Defensive geraten. Das betrifft natürlich auch die LSAP. Es gilt jedoch den Sozialstaat in gerechter Weise zu modernisieren - dies ist in besonderem Maße die Aufgabe der Sozialdemokratie, die konkrete, finanzierbare und sozial gerechte Vorschläge entwickeln muss. Wesentliche Akzente der LSAP-Politik betrafen in den letzten Jahren besonders Gesellschaftsthemen (u.a. Sterbehilfe, Homo-Ehe, Ausländerwahlrecht).
Fortschritte in diesen Bereichen sind grundsätzlich zu begrüßen aber dies genügt nicht, um die Identität der Partei ausreichend in der Öffentlichkeit darzustellen; denn die Positionen in diesen Bereichen werden mittlerweile auch von anderen Parteien geteilt. Die Unterscheidbarkeit der LSAP zu anderen Parteien liegt in einer pragmatischen und realistischen Politik der sozialen Gerechtigkeit. Das Thema der sozialen Gerechtigkeit und "progressistische" Positionen in allen Politikfeldern müssen im Detail analysiert und stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. Dies ist umso wichtiger, als auch in Luxemburg Ungleichheiten aller Art tendenziell eher zu- als abnehmen. Richard G. Wilkinson and Kate Pickett haben in ihrem Buch The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better die Wichtigkeit von Gleicheit für eine Gesellschaft aufgewiesen. In seinem Buch The Price of Inequality tat der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz Ähnliches für die Wirtschaftsleistung von Nationen. Der französische Ökonom Thomas Piketty hat mit seinem Buch Capital in the 21st Century eine lebhafte und wichtige Debatte über grundlegende Fragen der Einkommens- und vor allem Vermögensverteilung angestoßen - die LSAP sollte diese Fragen für Luxemburg aufgreifen. Auch strittige oder vernachlässigte Themen, die zu einer verbesserten sozialen Gerechtigkeit beitragen können, müssen in der LSAP auch längerfristig und unabhängig von Koalitionszwängen und -programmen diskutiert und gemeinsam mit der Zivilgesellschaft erörtert werden. Zu den möglichen Themen solcher Debatten gehören unter anderem: eine kohärente Logementspolitik (mit klaren und durchgreifenden Maßnahmen gegen Spekulation), eine sozial gerechte Steuerreform, die Möglichkeit einer „klugen" Erbschaftssteuer (mit Ausnahmetatbeständen für Betriebe und Immobilien die vom Erbenden tatsächlich bewohnt werden), die notwendige Reform der Grundsteuer, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Bekämpfung des Armutsrisikos von allein erziehenden Müttern oder eine stringente Kulturpolitik.
Ein zweiter Schwerpunkt betrifft das Thema der Nachhaltigkeit, im generellen Sinne, sowie der Umwelt, die beide stärker berücksichtigt werden sollten. Seit dem Brundtland-Bericht von 1987 und der UN-Konferenz zu Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro von 1992 sind Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung Bestandteil der Agenda internationaler Organisationen, zivilgesellschaftlicher Initiativen und nationaler Regierungen. In Wissenschaft und Politik herrscht Konsens darüber, dass die moderne Gesellschaft einen nachhaltigen Entwicklungspfad in dem Sinne einschlagen muss, dass sich die Ressourcen Bestände an "Naturkapital" nicht erschöpfen oder verschlechtern dürfen, da von ihnen Leben, Wachstum und Wohlstand in der Zukunft abhängen. Nachhaltige Entwicklung erfordert auch, dass die Chancen zukünftiger Generationen zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse so groß sein müssen, wie die der heutigen Generation. Es handelt es sich hier um einen Aspekt, der hauptsächlich den Grünen als Kompetenzfeld zugeschrieben wird. Nachhaltigkeit ist jedoch ein Querschnittsthema, das alle Politikfelder berührt: die öffentlichen Finanzen, Renten, die Generationengerechtigkeit allgemein, letztlich natürlich auch die Umwelt. Nachhaltigkeit ist wesentlich für jede Partei, denn die von ihr verfolgten Ziele machen nur dann Sinn, wenn sie nachhaltig, über einen längeren Zeitraum hinweg, erreicht werden können. Nachhaltige Reformen sind politisch besonders schwierig und bedürfen daher einer ausgiebigen Öffentlichkeitsarbeit. Es soll nachvollziehbar sein, warum eine Reform, auch wenn sie Kürzungen beinhaltet, für die Gesellschaft von Nutzen sein kann. Als typisches Beispiel sei die Rentenreform der letzten Regierung unter sozialistischer Federführung genannt. Die Reform war notwendig, und sie zeigt, dass die Sozialisten in ihrem Kernkompetenzbereich zukünftige Probleme heute schon anpacken, und nicht bis übermorgen aussitzen.
Eine demokratische und gerechtere Gesellschaft und die Sicherung des sozialen Zusammenhalts sind und bleiben der politisch-programmatische Identitätskern der Sozialdemokratie, die über eine Politik der Grundrechte, der sozialen Gerechtigkeit in Verbindung mit wirtschaftlicher Innovation ins Werk gesetzt werden muss. Sozialdemokratische Politik muss Herz und Verstand, Leib und Seele haben. Der Frage der sozialen Gerechtigkeit und der realen Chancengleichheit muss weiterhin eine besondere Bedeutung für die LSAP haben. Die LSAP sollte die Partei sein, die politische Inhalte ganz konkret, zuerst im Hinblick auf Gerechtigkeits- und Chancengleichheitsfragen, beleuchtet. Die Aufgaben des Sozialstaates beziehen sich insbesondere auf fünf große Handlungsbereiche: Gesundheit, Erziehung/Bildung/Kultur, Wohnen, soziale Sicherheit und personenbezogene Dienstleistungen. Schlussendlich sollte die Gerechtigkeitsfrage auch intergenerationnel gestellt werden: Die Rechtsansprüche die heute angehäuft werden, bilden zum Teil eine unangemessene Belastung der jüngeren Generationen. Die LSAP sollte sich aktiv für intergenerationnelle Gerechtigkeit einsetzen, um die Gestaltungsfreiheiten der zukünftigen Generationen zu gewährleisten. Die von der Sozialdemokratie erwarteten Antworten auf die als Bedrohung empfundene soziale, aber auch kulturelle und politische Verunsicherung sollten im Idealfall wichtige Bestandteile einer neuen sozialdemokratischen „Erzählung" (narrative) bilden. Soziale und wirtschaftliche Sicherheit, gesellschaftliche Anerkennung und Zusammenhalt sowie demokratische Teilhabe erfüllen keinen Selbstzweck. Politik, Gesellschaft und Wirtschaft sind gefragt, einen Beitrag zur Lebenszufriedenheit, zur Selbstverwirklichung und zum Glück der jeweiligen Bevölkerung zu leisten. In seinem Buch Ill Fares the Land, plädierte der Historiker Tony Judt zu Recht für eine Neuentdeckung der ethischen Sicht auf das, was eine gute Gesellschaft ausmacht, und was ein legitimer Weg ist, dies zu verfolgen und was nicht. Folgende Eckpunkte können hier genannt werden:
(i)die Qualität der Demokratie; die politische und gesellschaftliche Grundordnung im Sinne von materieller Rechtsstaatlichkeit, sozialer Gerechtigkeit und inhärenter Nachhaltigkeit; ein ausreichender Gleichheitsgrad (neben dem materiellen Element auch vor allem bei Gender-Fragen und beim Zugang zu Bildung und Kultur); Gesundheit und Gesundheitsvorsorge; und Beschäftigung (d. h. Arbeit statt Transferzahlungen) .
Für die sozialdemokratischen Parteien in Europa sind die Gewerkschaften dabei in der Regel schwierige, aber strategisch wichtige Partner. Natürlich muss die LSAP sich fragen, ob diese Partnerschaft mehr sein soll als einfaches Mitläufertum, als Befehlsempfänger der Gewerkschaften. Besonders in Krisenzeiten muss eine Partei staatserhaltend sein und kann eher weniger fordern als verteidigen. Sie muss jedoch bei der Verteidigung des Sozialstaates Innovation und gerechte Modernisierung vertreten anstatt nur Errungenschaften abzusichern. Sie muss daneben in der Regierung den Konsens suchen anstatt immer nur die Konfrontation zu pflegen.
Starke Gewerkschaften sind natürlich eine Grundbedingung, um die kollektiven Werte eines Gesellschaftsmodells voranzutreiben. Indes befinden sich die Gewerkschaften selbst auch in schwierigem Fahrwasser. Durch die Herausforderungen im Organisationswesen, der Mitgliederrekrutierung und der Sozial- und Fiskalpolitik stehen sie heute unter Druck, der zum Teil einen Profilierungszwang gegenüber den sozialdemokratischen Parteien auslöst, was das Reservoir ihrer Gemeinsamkeiten mit diesen Parteien einschränkt und weniger Kompromisse und gemeinsame Strategien möglich macht. Auch drohen sich die Milieus gemeinsamer Organisationszusammenhänge aufzulösen: weniger doppelte Mitgliedschaften und weniger hochrangige Gewerkschaftsvertreter in den Parlamenten oder Parteiausschüssen. Die LSAP als Partei sollte dem OGBL ein Gesprächsangebot zur Erneuerung des Dialogs machen, um wieder auf eine positive Art und Weise ein Bündnis jener sozial-fortschrittlichen Kräfte in Luxemburg zu verkörpern, die den Anforderungen, des luxemburgischen Modells gerecht werden. In diesem Kontext müssten natürlich beide Partner, nicht nur die LSAP, sondern auch die Gewerkschaften bereit sein ihre Position zu überdenken (Haushaltspolitik, Arbeitslosigkeit, Effizienz des Arbeitsmarktes). Besondere Aufmerksamkeit müsste dem Thema der interkulturellen Dimension des Sozialdialogs gewidmet werden: es geht darum diese neue Vielfalt zu bündeln, im Sinne eines konstruktiven, pragmatischen Reformdialogs, wo nicht Ideologie federführend ist, sondern der Anspruch einer empirischen Sachlichkeit.
(ii) Mehr konkrete Kompetenz in der Finanz- und Haushaltspolitik entwickeln. Sozialdemokratische Politik hängt auch von staatlicher, und vor allem finanzpolitischer, Handlungsfähigkeit ab - höhere Defizite mögen deshalb kurz- bis mittelfristige Resultate eines aktiven Staates sein, engen später die Gestaltungsspielräume jedoch ein. Die LSAP sollte klare eigene Vorschläge in Bezug auf die Staatsfinanzen machen. Ein Vorschlag der LSAP zu einer grundlegenden Steuerreform wäre besonders wichtig. Von Bedeutung im Budget sind vor allem die Qualitätsansprüche in der Investitionspolitik, eine neue Kultur der Ausgaben, und soziale Selektivität (vor allem der wirklich Schwächere soll geschützt werden) um der Haushaltspolitik eine sozialdemokratische Substanz zu geben. In diesem Kontext ist es auch unbedingt nötig, neue gesetzliche Regeln zu definieren, damit mittelfristig ein Budget der so genannten „neuen Generation" anhand dieser Normen aufgestellt werden kann. Diese Themen waren im Wahlkampf wichtig - die LSAP sollte alles drangeben sie in der heutigen Koalition mit den Partnern durchzusetzen. Es ist gewusst, dass eine weitere Verschuldung gestoppt werden muss und neue Prioritäten für eine (zukunfts)gerechtere und nachhaltigere Ausgabengestaltung gesetzt werden müssen. Ziel ist es, die Zinslasten für den Staatshaushalt zu senken und dadurch öffentlichen Gestaltungsspielraum für nachhaltige Zukunftsinvestitionen zurück zu gewinnen. Denn nur ein finanziell potenter Staat kann Bildung, Kultur, Sicherheit, Forschung und Entwicklung, soziale Absicherung und andere öffentliche Güter für alle Bürger auf Dauer sicherstellen. Der Maßstab für die soziale Einbettung der Märkte ist die Sicherung der gleichen Lebenschancen und der gleichen Würde aller. Die Voraussetzungen für die Selbstachtung des Einzelnen, seine soziale Anerkennung und seine materielle Lebenssicherung müssen gleichermaßen gewährleistet werden. Nur eine solche Strategie der Gerechtigkeit hält eine moderne Gesellschaft nachhaltig zusammen.
(iii) Rechtsstaatlichkeit stärken und eine neue Kultur der Verantwortlichkeit fördern. Die übergeordnete Bedingung einer sozialdemokratischen Politik ist die Sicherung der Stabilität und die Handlungsfähigkeit des demokratischen Rechtsstaates, der die Grundrechte aller seiner Bürger wirksam zu schützen vermag. Die LSAP sollte öffentlich dafür eintreten die Grundrechte in der Verfassung zu stärken und auf neue Gebiete ausdehnen. Dies in der Tradition von Robert Krieps und dem deutschen Sozialdemokraten Adolf Arndt der für die Entwicklung verantwortlich war, dass an die Stelle des formalen Rechtsstaates nun der materielle Rechtsstaat (auf Basis der Grundrechte) und an die Stelle des liberalen der soziale Rechtsstaat trat. In dieser Richtung muss die LSAP aktiv in die Debatte um den Rechtsstaat und die Grundwerte im Rahmen der Verfassungs- und der Justizreform eingreifen und aktiv den Dialog zum gemeinsamen Austausch mit den Menschenrechtsorganisationen suchen.
(iv) Eine nachhaltige Entwicklung unserer Wirtschaft aktiv vorantreiben. Was den Bereich der Umwelt anbelangt, konnte die LSAP bisher nur punkten, wenn sie den entsprechenden Minister stellte. Die LSAP hat, im Gegensatz etwa zu den Sozialdemokraten im Europäischen Parlament, ein zu schwaches umweltpolitisches Profil. Die Idee der "green jobs" etwa, als Schnittpunktmenge grüner und sozialdemokratischer Politik, sollte stärker von der LSAP beansprucht und umgesetzt werden. Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung beruht auf drei Säulen: sie beinhaltet eine wirtschaftliche, eine soziale und eine ökologische Komponente. Es gilt eine Wirtschaftsdynamik anzupeilen, die sowohl ermöglicht die soziale Kohäsion der Gesellschaft zu garantieren, als auch ausreichend Mittel zu generieren um die die sozialen Systeme abzusichern, wobei diese Entwicklung einer umweltfreundlichen und ökologischen Orientierung folgen soll. Es braucht zunächst eine Bestandsaufnahme, die bereits teilweise existiert (vgl. die Untersuchungen des STATEC, auch Teile des Rapport Fontagné sind als Warnsignal brauchbar), aber weiter unter sozialdemokratischen Gesichtspunkten vervollständigt werden muss. Wir brauchen einen neuen Begriff von Wachstum, der auch berücksichtigt, wie Wohlstand verteilt ist und ob er nachhaltig ist. Ein neuer Begriff von Fortschritt muss qualitativ sein und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger ins Zentrum rücken. Denn oft klaffen die Wachstumszahlen der Statistiker und die Zufriedenheit der Menschen auseinander. Eine ökologische Industrie- und Wirtschaftspolitik zielt auf den Ausbau erneuerbarer Energien und auf die Substitution fossiler und knapper Rohstoffe durch erneuerbare und nachwachsende Rohstoffe, sowie auf eine Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz. Die LSAP sollte eine Dynamik entwickeln, die Klimaschutz und Energiewende als neue Zukunftsmöglichkeit fördert. Die Strategie der Diversifizierung ist seit Jahren das Mantra der Luxemburger Wirtschaftspolitik, doch es stellt sich die Frage, welche spezifischen Überprüfungsinstrumente es in diesem Zusammenhang gibt, die die Koordination und Umsetzung dieser Politik besser ermöglichen würde? Als kleine offene, im Finanzwesen spezialisierte Volkswirtschaft hat Luxemburg einen „dependancy path", doch unsere Wirtschaftsgeschichte zeigt auch, dass unser Land verschiedene Neuorientierungen bereits erfolgreich umgesetzt hat. Wer allerdings vom möglichen Wachstumstreiber Umwelttechnologie profitieren möchte, muss jetzt noch stärker die Weichen für eine ökologische Industriepolitik stellen. Neue ökologische Technologie- und Produktionscluster bilden sich jetzt und nicht erst in zehn Jahren. Daneben geht es auch darum die Potenziale der Kreativwirtschaft für Wachstum, Beschäftigung und Innovation besser zu fördern, statt die immensen Chancen dieser Branche zu verspielen. Luxemburg braucht deshalb dringend ein neues, nachhaltiges Fortschrittsmodell für eine dritte industrielle Revolution. Des Weiteren muss natürlich auch die soziale Komponente in diesem Zusammenhang berücksichtigt werden um eine ökologische Politik möglichst sozial verträglich und gerecht zu gestalten. Im Sinne einer sozialdemokratischen Politik, muss die LSAP die Partei sein die alle drei Komponenten berücksichtigt und in die Gestaltung der Politiken einfließen lässt.
(v) Mehr Glaubwürdigkeit und Transparenz als demokratische Grundwerte entwickeln. Es ist besonders für eine linke Partei unabdingbar, dass ihre Vertreter als unabhängig, glaubwürdig und allein dem Gemeinwohl verpflichtet, von den Wählern wahrgenommen werden. Die ethischen Anforderungen an Mandatsträger einer Partei der sozialen Gerechtigkeit sind besonders hoch und heute auch wichtiger denn je. Denn Politikverdrossenheit breitet sich auch in Luxemburg immer weiter aus. Die Bürger sind nicht der Überzeugung, dass die Parteien in der Lage oder willens sind ihre Probleme zu erkennen und zu lösen. Teile der Bevölkerung haben ihr Vertrauen in die Politik und die Politiker selbst verloren. Im Hinblick auf mehr Integrität muss eine verstärkte Deontologie der politischen Mandatsträger als Initiative der LSAP dargestellt und sichergestellt werden. Vetternwirtschaft oder gefühlte Vetternwirtschaft durch kleine Geschäfte zwischen Freunden, insbesondere in einem kleinen Land wie Luxemburg, sind eine Gefahr für den Rechtsstaat. Auf kollektiver Ebene geht es deshalb einerseits darum, mögliche persönliche Willkür von Mandatsträgern zu ersetzen durch transparente, professionelle und faire Prozeduren - auf individueller Ebene geht es darum, die Möglichkeit von Interessenkonflikten denen ein einzelner Mandatsträger ausgesetzt wäre, durch eine Politik der Transparenz zu minimieren. Reale oder gefühlte übergroße Nähe oder wirtschaftliche Beziehungen zu Finanziers oder Unternehmern sollten überdacht und vermieden werden. Es ist grundsätzlich wichtig, dass alle möglichen Interessenkonflikte im weitesten Sinne, sei es vor allem durch Kapitalbeteiligungen, Verwaltungsrats- oder Aufsichtsratsmandate, offen gelegt werden.
b. Organisation der Partei - Reformen für eine bessere Einbindung der Mitglieder
Die LSAP muss sich nicht nur inhaltlich weiterentwickeln, sondern auch organisatorisch erneuern. Eine Partei der Reformen muss immer auch zur eigenen Reform fähig sein. Beides gehört zusammen. Nur mit einer schlagkräftigen Organisation können überzeugende Inhalte mehrheitsfähig und umgesetzt werden. Doch eine Partei der demokratischen Linken ist keine bürgerliche Partei. Eine linke Volkspartei will und muss Menschen aus allen sozialen Schichten dazu bewegen, sich politisch zu betätigen. Dazu braucht sie einen Apparat, der dies ermöglicht, und Strukturen, die die politisch engagierten Menschen aufnehmen. Dabei haben die verschiedenen Strukturen ihre jeweilige, möglichst präzise Aufgabe. Diese Aufgaben können in der Freizeit ausgeübt werden, oder auf professioneller Ebene. Beides ist wichtig! Dabei ist klarzustellen, wie letztere kontrolliert und bewertet wird. Mit der Parteien- und Fraktionsfinanzierung verfügt auch die LSAP über Mittel, einen professionellen Apparat aufzubauen. Zu dem professionellen Apparat gehören die Mandatsträger und angestellten Mitarbeiter. Zu dem nebenamtlich betriebenen Apparat gehören vom Parteitag gewählte Parteimitglieder. Es muss dafür gesorgt werden, dass diese beiden Kategorien im gegenseitigen Respekt der demokratischen Gepflogenheiten agieren.
Auf nationaler Ebene verfügt die LSAP über ein Sekretariat mit vier Angestellten während die Parlamentsfraktion 11 Angestellte beschäftigt. Gesetzlich sind Partei und Fraktion organisatorisch getrennt, deren Mittel ebenfalls. Zu untersuchen ist, inwiefern die Fraktionsangestellten in die inhaltliche Arbeit einbezogen werden können. Eine bessere Koordination kann Synergien entstehen lassen. Insgesamt ist zu untersuchen, welche Berufsziele dem Parteipersonal vorrangig vorzugeben sind bezw. wie solche Objektive ausgefüllt werden. Jedoch sollte immer auch die Qualität der Arbeit der jeweiligen Mitarbeiter überprüft werden und über mögliche (interne und externe) Fortbildung nachgedacht werden. Wenn das Partei- oder Fraktionspersonal andere berufliche Aufgaben übernimmt (Ministerium, Cour des Comptes u.a.), sollte versucht werden, sie weiterhin in die inhaltliche Arbeit einzubinden damit ihre Kompetenzen nicht für die Partei verloren gehen. Ein Register sollte ehemalige Mitarbeiter als Experten aufführen, die bei Bedarf kontaktiert und in Arbeitsgruppen eingebunden werden können.
Luxemburg hat zwei Verwaltungsebenen: eine kommunale und eine nationale. Dazwischen gibt es die Ebene der Wahlbezirke, die in der LSAP durch eine eigene Bezirksstruktur wahrgenommen wird. Diese Struktur hat in der Hauptsache eine Rolle bei der Vorbereitung der Landeswahlen. Auf kommunaler Ebene sind Ortsvereine notwendig, um Kommunalwahlen zu bestreiten. Angesichts der immer zahlreicheren Proporzgemeinden ist es eine dringende Aufgabe der Parteiführung, den Apparat an Ortsvereinen systematisch auszubauen, um überhaupt an Kommunalwahlen teilnehmen zu können. Die Parteizentrale soll vorausschauend untersuchen, wie die Ortsgruppen für die Kommunalwahlen von 2017 aufgestellt sind, beziehungsweise welche Ortsgruppen zu beleben oder neu zu schaffen sind. In starken LSAP-Kommunen gilt es diese Stärke auf die nationale Ebene zu bringen.
Bei den Wahllisten ist es besonders wichtig, auf eine ausgeglichene Wahlliste zu achten (Jung/alt, Männer/Frauen und bei Europawahlen eine Ausgewogenheit der Bezirke). Eine klare Strategie zur Erneuerung des parteipolitischen Personals ist zurzeit noch nicht ersichtlich. Eine graduelle Erneuerung des politischen Personals und der Kandidaten muss jedoch von der Partei aktiv unterstützt werden. Die jeweiligen Kandidaten brauchen die Unterstützung von allen Amtsträgern und Mitgliedern, die von einem zentralen Wahlkampfmanagement koordiniert werden muss.
Leider verkommen die (zu) zahlreichen innerparteilichen Strukturen, falls sie überhaupt tagen, oftmals zu reinen Zuhörer- oder bestenfalls Debattierklubs. In vielen Sektionen kommt die politische Arbeit zu kurz und wird lediglich durch Freizeitaktivitäten kompensiert. Besonders im ländlichen Raum ist die Organisation der Partei lückenhaft: es gibt immer mehr Gemeinden, in denen die Partei nicht als Organisation vertreten ist, viele Fusionen werden dann vorgenommen. Die innerparteiliche Organisation ist mittlerweile eine Schwäche der LSAP. Sie umfasst die nationalpolitische Rolle der Parteileitung, die zu viel durch die Zwänge, die die Regierungsbeteiligung der LSAP mit sich bringen (und die in erster Linie die Regierungsmitglieder und die Parlamentsfraktion betreffen sollten), eingeschränkt wird. Die Rolle der Bezirksvorstände gehört auf den Prüfstand. Nachdenken sollte man deshalb auch über eine stärkere Professionalisierung durch ständige Mitarbeiter oder Ansprechpartner (Referenten), die als Bindeglied zwischen den Sektionen eines Bezirks agieren sollen. Auf Bezirksebene sind die Aufgaben der Vorstände zwar in den Statuten der Partei definiert, aber es scheint, dass ihre Rolle zu sehr auf die Wahlkämpfe limitiert ist; in der Praxis fungieren sie, wenn überhaupt, als Treffpunkt von Mitgliedern verschiedener Sektionen. Was die Sektionen betrifft, so ist es bekannt, dass verschiedene Sektionen ganz gut "funktionieren", andere wiederum nicht. Die LSAP benötigt allgemeine eine stärkere Vernetzung der verschiedenen Organe/Ebenen der Partei erreicht werden.
Parteileitung und Kongress sind die wesentlichen Organe für die politische Willensbildung, die Stellungnahmen der LSAP zur Politik des Landes in allen Bereichen und die Führung des gesamten Parteiapparates. Von der Art und Weise wie diese Organe arbeiten, hängt der Zustand der Partei ab. Deshalb sollte es alljährlich eine ehrliche und tief greifende Analyse der Arbeitsweise und der Zusammenarbeit dieser Organe geben.
Die Parteileitung besteht aus einer Exekutive und den anderen Mitgliedern der Parteileitung, die mit der Zeit immer zahlreicher wurde, um die Bezirke und Unterorganisationen mit in die Parteiführung einzubinden. Sie besteht also aus vom Kongress gewählten und von der Gesamtpartei legitimierten Mitgliedern, wie auch aus kooptierten Mitgliedern. Eine solche zweigleisige Zusammensetzung schwächt die politische Führungskraft, denn die Unterorganisationen, denen eine größtmögliche Gestaltungsfreiheit zusteht, müssen nicht unbedingt in allen Fragen auf derselben Linie wie die gewählten Amtsträger sein. Eine Reform (und Verkleinerung) der Parteileitung drängt sich auf, damit dort wirklich Entscheidungen getroffen werden können.
Daneben stellt sich dann auch die Frage ob der Generalrat ein Gremium sein könnte, in dem politische Themen ausführlich diskutiert würden. Man könnte den Generalrat konsequent aufwerten und verstärkt als Beratungsorgan, wie in den Parteistatuten vorgesehen, einsetzen. Dadurch würde wahrscheinlich auch die interne Kommunikation verbessert.
Was die Unterorganisationen angeht, ist zu untersuchen, wie effizient sie noch arbeiten und ob man nicht Strukturen, Formalitäten und Regularien straffen kann. Macht es noch Sinn, eine leider immer ineffizientere Jugendorganisation bis zum Alter von 35 Jahren zu haben und Kräfte in Grabenkämpfen, spezifischen Prozeduren und Formalitäten zu binden, die besser in der Basis- und Parteiarbeit selbst (sowie auch im Wahlkampf) gebraucht würden. Wäre es nicht besser für die Jungsozialisten, sich prioritär und gezielt der wirklich basisorientierten Jugendarbeit zu widmen, statt zu versuchen sich als vermeintlich zukünftige Mandatsträger auf Kongressen zu profilieren?
Macht es Sinn, Bezirksparteitage zu organisieren, wenn die Probleme heute überall im Land ähnlich sind? Wäre hingegen eine Stärkung der Ortsvereine/Sektionen nicht ein Weg näher zu den einzelnen Mitgliedern vorzudringen - also eine verstärkte Dualität national/lokal?
An der Spitze der Parteiführung steht der Parteipräsident. Die LSAP verbietet dem Präsidenten, ein Ministeramt auszuüben, aber nicht das Bürgermeisteramt einer großen Stadt oder ein Abgeordnetenmandat, obschon alle drei Arten von Ämtern sehr zeitraubend sind. Die Dreiteilung der obersten Verantwortung in der Partei besteht noch immer: einerseits der Parteipräsident, andrerseits der Chef der Regierungsmannschaft und der Fraktionspräsident.
Die Frage einer besseren Zusammenarbeit und eines besseren Informationsflusses zwischen Partei einerseits und Regierung und Fraktion andererseits muss gestellt und gelöst werden. Die LSAP braucht eine stärkere Beteiligung der Mitglieder in die Partei in Form von Mitgliederbefragungen, Mitgliederentscheiden und Sektionsbefragungen. In der LSAP wächst, auch mit zunehmender Dauer der Regierungsbeteiligung, die Unzufriedenheit der Mitglieder durch eine mangelnde Einbindung in wichtige Entscheidungen der Partei. Parteikongresse sind immer weniger Ort eines Meinungsaustauschs- und Meinungsfindungsprozesses der Partei. Direkte Beteiligung der Mitglieder an der Gestaltung der Politik der LSAP gibt es, trotz hoher Anzahl von Arbeitsgruppen, kaum. Die LSAP muss daher das interne Recht auf Beteiligung und Mitsprache verbessern und erweitern um dadurch die interne Demokratie zu stärken. Die Einführung von Mitgliederbegehren und interner Umfragen (auch digitaler Art) wäre daher sinnvoll. Es gilt also allgemein: "Mehr Demokratie zu wagen": sowohl innerparteilich, als auch im nationalen Rahmen.
Die Gewinnung neuer Mitglieder muss eine Priorität für jedes Parteimitglied werden. Die LSAP braucht daneben eine bessere Mitgliederbetreuung. Besonders im ersten Jahr sollten die Mitglieder intensiv betreut und ihnen die Partizipationsangebote innerhalb der LSAP näher gebracht werden. Zudem ist eine schnelle Kontaktaufnahme mit den neuen Mitgliedern direkt nach dem Eintritt vonnöten. Förderlich wären, die Einführung von Neumitgliederseminaren und die Einsetzung von Mentorinnen und Mentoren für Neumitglieder. Jeder Ortsvorstand sollte einen sprachkundigen Ausländerbeauftragten haben. Man sollte gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung tragen und verstärkt auf Ausländer (u.a. SPIC) und die Luxemburger Grenzgänger zugehen. Eine weitere Möglichkeit wäre die Installation von Mitgliederbeauftragten innerhalb der Bezirksvorstände die einen jährlichen Mitgliederentwicklungsbericht verfassen. Der Mitgliederbeauftragte ist für die Betreuung der Mitglieder, speziell ihre Bindung, Einbeziehung ins politische Tagesgeschäft sowie gegebenenfalls für die Rückgewinnung (nach Parteiaustritten) zuständig. Um eine gewisse Professionalität sicherzustellen und gleichzeitig Standards zu definieren, sollen die Mitgliederbeauftragten regelmäßig geschult werden und sich in Konferenzen untereinander austauschen können. Die LSAP muss gezielt mehr Frauen, junge Arbeitnehmer und Uniabsolventen und Ausländer ansprechen. Die meisten „Parteinotablen" sind seit den 80er Jahren in der Politik engagiert, der Altersdurchschnitt der LSAP-Regierungsmitglieder ist außergewöhnlich hoch: eine gewisse Ermüdungserscheinung, sowohl der langjährigen Mandatsträger als auch der Wähler, ist unvermeidlich. Hier wäre heute eine systematische und strategisch durchdachte Erneuerung der Parteispitze, der Mandatsträger und der Wahllisten, unter anderem durch eine verstärkte Einbindung der jüngeren Parteimitglieder, förderlich.
Trotz zahlreicher „Wiederbelebungsversuche" funktionieren die Arbeitsgruppen immer noch nicht in einem ausreichenden Maße. Dies hat ernsthafte Konsequenzen, denn Sinn und Zweck der Arbeitsgruppen ist u.a. das Einbringen von fachspezifischen Kompetenzen und die politische Bindung (teilweise wohl auch politische Bildung) derjenigen, die an diesen Arbeitsgemeinschaften teilnehmen. Das Fehlen dieses Fachwissens erschwert die Arbeit der Partei und der Parlamentsfraktion. Gefordert, im Sinne der Aktivierung der Arbeitsgemeinschaften, sind hier besonders die Abgeordneten und Mitglieder der Parteileitung, die sich gemeldet haben, die jeweiligen Arbeitsgemeinschaften zu leiten. Andere wesentliche Kompetenzen sind vorhanden: bei den Mitarbeitern der Partei, bei den Fraktionsmitarbeitern sowie allgemein bei den Mitgliedern der Partei. Erfahrungsgemäß werden vorhandene Kompetenzen nur unzureichend abgerufen. Arbeitsgruppen sollten nicht künstlich am Leben erhalten werden, sondern sie sollten vielmehr konkret themenbezogen und punktuell eingesetzt werden. Dazu stellt sich auch die Frage der Koordination, Betreuung und Verwaltung des erlangten Wissens.
Des Weiteren, sollte die LSAP im Sinne einer Öffnung nach außen, vermehrt den Dialog mit allen Kreisen der Zivilgesellschaft suchen. In den 70er Jahren waren viele bekennende Parteimitglieder in gemeinnützigen Vereinen vertreten (Amnesty International, Planning familial, kulturelle und soziale Vereinigungen etc.) Parteimitglieder und Mandatare müssen sich wieder verstärkt in der Zivilgesellschaft engagieren. Die Vernetzung einer Partei in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen ist von ungemeiner Wichtigkeit, um Partei-positionen mehrheitsfähig zu machen und die Bürgerinnen und Bürger für die eigene Politik zu sensibilisieren.
Die LSAP sollte deshalb verschiedene Organisationen, welche den Werten der LSAP (Freiheit, Gleichheit und Solidarität) nahe stehen, zur Diskussion und Zusammenarbeit einladen. Ein Hauptaugenmerk legt man hier sicherlich auf die Kooperation mit den Ge-werkschaften. Die LSAP benötigt eine neues Bündnis Arbeit-Kultur-Wissenschaft. „Aber es lohnt sich, zur Kenntnis zu nehmen, dass es - zumal im Umkreis künstlerischer, intellektueller, wissenschaftlicher Berufe - nicht jedermanns Sache ist, sich parteipolitisch formell zu binden. Dies zu begreifen gehört ebenfalls zur Verantwortung für die Partei der Freiheit. Mündige Bürger können in unterschiedlichen Formen des Zusammenwirkens Nützliches bewirken. Zur Mitarbeit sollten auch Nichtmitglieder willkommen sein." meinte Willy Brandt 1987. Hierbei kann die Fondation Robert Krieps eine wertvolle Möglichkeit sein, Bürgern die vielleicht Berührungsängste mit Parteien haben, eine Diskussionsplattform zu geben. Grundsätzlich ist es sinnvoll, Nichtmitglieder in die Diskussionskultur der Partei einzubeziehen. Auch die Öffnung von Themenforen und Arbeitsgemeinschaften (zur temporären, thematisch bezogenen Mitarbeit) ist ein sinnvolles Mittel, um die Partei zu öffnen und dann auch thematisch breiter aufzustellen.
Zum Schluss dieses Abschnittes noch ein Bündel konkreter Maßnahmen:
Allgemeine Reform der Parteileitung (Zusammensetzung, Funktion als Diskussionsforum, Entscheidungsgremium). Schaffung eines regelmäßigen Tagesordnungspunkts komplementär zu den Resultaten der Arbeitsgemeinschaften um diese in die Diskussion zu integrieren.
Monatliche Briefings per E-Mail an alle Parteimitglieder. Diese Briefings sollten unter anderem die Aktivitäten der Minister und der Abgeordneten angeben.
ein Register von verschiedenen Personen und ihren Kompetenzen aufstellen, die bei Bedarf kontaktiert und in Arbeitsgruppen eingebunden werden können.
Mentoring vor allem für neue Parteimitglieder einführen, um wichtige Erfahrungen an junge Parteimitglieder weitergeben zu können und den Nachwuchs aufzubauen (Einführung eines Mentorenregisters).
bessere Mitgliederbetreuung. Schnelle Kontaktaufnahme mit den neuen Mitgliedern direkt nach dem Eintritt (mit spezifischem Informationsmaterial zu Partei und Politik d.h. über die Geschichte der Partei, die Mandatsträger, Argumente in der politischen Diskussion etc.). Einführung von Neumitgliederseminaren und Ausländerbeauftragen für die ausländischen Neumitglieder in größeren Ortsvereinen.
Staffelung der Mitgliederbeiträge überdenken.
Spezifische Bildungsangebote für die Sektionsvorstände (Statuten, Sektionsführung, Sekretariat, Mitgliederbetreuung, Finanzen, Infoblatt) organisieren.
Kontaktpersonen und/oder Kontaktstellen für Parteibasis klar definieren und klar aufzeigen.
Mandatsträger sollten stärker auf die Sektionen zugehen und dort als Impulsgeber und Multiplikatoren mitarbeiten.
Quantitative und qualitative Analyse der Parteiaustritte. Wie bedeutend ist die Zahl der Parteiaustritte? Warum treten Parteimitglieder aus und welche Konsequenzen sind daraus zu ziehen?
Konkrete Jugendarbeit fördern, die Jugend stärker einbinden und das Alter für Jungsozialisten auf 30 Jahre senken.
Politische Arbeit müsste stärker in den Arbeitsgruppen mit externen Experten vorbereitet werden;
die Partei intern stärker vernetzen.
die nun anberaumten Gespräche der Parteiexekutive mit den Bezirksvorständen sollten institutionalisiert werden und regelmäßig (jährlich oder alle zwei Jahre) stattfinden; so kann die Parteiexekutive Kenntnis über die gesamte Organisation erlangen.
ein jährliches Treffen der Bezirksvorstände mit den Sektionen bzw. deren Mandatären institutionalisieren.
Bezirksvorstände könnten sich untereinander treffen, mit dem Ziel, mehr Aktivitäten zu generieren (best practices). Es fällt auf, dass die „regionalen" Wahlkämpfe in den verschiedenen Bezirken stark divergieren.
in allen bestehenden und künftigen Proporzgemeinden eine eigene Sektion aufzubauen, um die kommunale Verankerung der LSAP auf Gemeindeebene zu festigen und weiter auszubauen. Zu viele Sektionsfusionen sind da keine Alternative.
Mehr innerparteiliche Transparenz: die Dokumente in den Kongressmappen, darunter die Aktivitätsberichte der Parteileitung, der Fraktion und der Bezirksvorstände, der Finanzbericht der Partei, sowie eine Liste der Kandidaturen, falls Parteiämter durch Wahlen besetzt werden, sollen den Delegierten eine gewisse Zeit vor dem Termin des Kongresses (elektronisch) zugesandt werden. Teile der Parteistatuten werden in der Praxis nicht angewendet: es soll daher eine Überprüfung der Statuten erfolgen, mit dem Zweck, dass diese für alle Beteiligten tatsächlich in der Praxis anwendbar sind und somit wieder auch einen bindenden Charakter für alle haben können.
Die Meinungen von Mitgliedern, Sektionen, Bezirksvorständen und lokalen Mandatsträgern angemessen berücksichtigen bzw. ein Mechanismus schaffen, im Rahmen dessen lokale und regionale Interessen parteiintern zur Sprache kommen können. Falls nationale Entscheidungen anstehen, die einen Einfluss auf Gemeinden und Regionen haben, sollte ein Dialog mit den betroffenen sozialistischen Gemeinderäten, Sektions- oder Bezirksvorständen hergestellt werden. Medienwirksame Aktionen von Bürgerinitiativen mit sozialistischer Beteiligung deuten darauf hin, dass ein innerparteilicher oder innerkoalitionärer Interessenausgleich nur unzureichend ausgebildet ist. Das „Gemengeforum" kann hier eine wichtige Rolle spielen.
Einführung eines „Gewerkschaftsforum" für Parteimitglieder, die in einer Gewerkschaft tätig sind und die manchmal das Gefühl haben, zwischen zwei Stühlen zu sitzen: hierüber könnte auch eine informelle Annäherung an die Gewerkschaften erfolgen (CGFP, FGFC, OGBL, FNCTTFEL).
Auf die Erfahrungen von ausländischen sozialdemokratischen Parteien zurückgreifen: verschiedene Herausforderungen der LSAP (sinkender Wähleranteil, Mitgliederentwicklung und die innerparteiliche Organisation) sind genereller Natur.
Die über weitaus mehr Mittel verfügenden Schwesterparteien der LSAP in Belgien, Deutschland und Frankreich und die FEPS haben Studien durchgeführt und, darauf folgend, Lösungsansätze formuliert und entsprechende Parteireformen durchgeführt. Die LSAP sollte Kontakt mit diesen sozialdemokratischen Parteien aufnehmen, um aus deren Erfahrungen zu lernen. Dazu gehören auch die regelmäßigen Reformprozesse dieser Parteien, die aufgrund von Wahlniederlagen, umgesetzt wurden.
c. Kommunikation - Kohärenz und Konsistenz der politischen Botschaften
Politik wird nicht nur gemacht, sie muss auch erklärt werden. Dies gilt besonders für sozialdemokratische Lösungsansätze, die sowohl sozial gerecht als auch wirtschaftlich vernünftig sein sollen. Dieser Kommunikationsaufgabe ist die LSAP, wenn sie in Regierungen vertreten war, in der Vergangenheit nicht immer nachgekommen. Das Lamentieren, dass vernünftige politische Entscheidungen nur ungenügend vermittelt wurden, bringt nicht weiter. Zum politischen Handwerk gehört neben seiner Umsetzung eben auch das Werben für und das Erklären von politischen Programmen. Drei Punkte sind für eine gute Kommunikation wichtig: die Botschaft, die spezifische Zielgruppe und das Instrument oder Medium. Wichtig ist es dabei, eine eigene angemessene Sprache und eigene Begrifflichkeiten zu finden, um sich von den politischen Konkurrenten abzusetzen. Die Menschen müssen verstehen für was die LSAP steht, was sie tut und warum sie es tut. Die Wähler wollen dabei nicht nur über den Kopf, sondern mit den richtigen Worten auch über das Herz angesprochen werden. Eine kommunizierte Botschaft soll informieren, überzeugen und motivieren.
Hierzu ist eine konsequente Professionalisierung des Parteiapparates und Koordination (nicht nur im Wahlkampf) in Sachen Öffentlichkeitsarbeit von Nöten (Ausarbeitung von grundlegenden Argumentationsketten, konsequentere Unterstützung der Kandidaten bei Wahlen, Ausarbeitung von zugänglichen Dateien von Presseartikeln und Positionspapieren). In diesem Kontext müsste die Partei sich auch intensiver mit der Frage auseinandersetzen, in welchem Maße die neuen Kommunikations- und Informationstechnologien als wichtige Katalysatoren der politischen Öffentlichkeit und als Instrument der Sozialisierung und Verständigung, benutzt werden können, um die oben genannte strukturelle Orientierung voranzutreiben. Der Internet-Auftritt der Partei ist zum Teil unübersichtlich und überholt. Wichtige Informationen sind nicht oder nur sehr schwer zu finden. Die Kommunikation über die sozialen Netzwerke muss ausgebaut werden, dabei sollte die „traditionelle" Kommunikation (Briefverkehr, Veröffentlichungen über den Postweg, Medien) jedoch nicht vernachlässigt werden. Parteimitarbeiter und Parteimitglieder sollten aufgefordert werden, systematisch die Stellungnahmen in sozialen Netzwerke und die Kommentare im Internet zu verfolgen und zu beantworten. Schlussendlich sollte auch ein lebendiger Ideenaustausch mit allen progressistischen Kräften dauerhaft - und unabhängig von der jeweiligen Regierungskoalition - etabliert und durchgeführt werden. Doch die beste Kommunikation richtet nichts aus, wenn nicht auch die Leistungsbilanz vorzeigbar ist.
Die neuen Abgeordneten der LSAP müssen stärker in Erscheinung treten (Parlamentarische Anfragen, Gesetzesvorschläge usw.). Mandatsträger sollten in ihrer individuellen Kommunikation doch nicht nur die eigene Leistung hervor streichen, sondern auch die Position und die Leistung der Partei.
Alle Kommunikation der Partei braucht inhaltliche und formale Kohärenz und Konsistenz. Die Aufgabenteilung zwischen Generalsekretariat und Fraktion in den Bereichen Koordination und Kommunikation sollte überprüft und besser aufeinander abgestimmt werden. Externe und interne Kommunikation sind stark vernetzt. Letztere muss in beide Richtungen zwischen Parteispitze und Basis (top-down und bottom-up) funktionieren, damit beide als Transmissionriemen von Inhalten funktionieren können. Auch müssten die parteiinternen Strukturen insofern verbessert werden, dass wenn ein Mitglied eine Frage zu einem bestimmten Thema hat bzw. Informationen sucht, diese schnellstmöglich erhält (z.B. müssten die jeweiligen Kontaktpersonen klar definiert sein).
Der öffentliche Diskurs spielt eine wichtige Rolle bei sozialdemokratischen Reformvorhaben. Argumente zählen. Es kommt entscheidend darauf an, Ideen mit guten kognitiven und normativen Argumenten zu unterfüttern. Aber die Argumente sollten auch einigermaßen kohärent, konsistent und stichhaltig sein, und die politischen Maßnahmen, die sie begründen, sollten zweckdienlich und konkret sein. Die Kommunikation der Partei könnte daneben auch öfters programmatische und historische Bezüge aufzeigen.
Willy Brandt sagte in seiner Abschiedsrede als Vorsitzender der SPD 1987: „Niemand muss mich darüber belehren, dass Mehrheiten nicht allein mit Programmen, auch nicht mit Geschichtsbüchern gewonnen werden. Nur, das Feuer der Begeisterung erlischt und die Quelle der Kraft versiegt, wenn die Grundlagen politischen Wirkens, nicht mehr im Ringen der Meinungen erarbeitet, sondern nur noch irgendwo eingekauft und irgendwie zugeliefert werden."
Die Partei kauft vor den Wahlen private Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Kommunikation. Es ist zu untersuchen, ob das Verhältnis zwischen Preis und Leistung dabei stimmt. Eine Überprüfung der Qualität und des Resultats drängt sich auf.
Die Luxemburger Presse ist keine Parteipresse mehr. Doch hier spielt auch die persönliche Verantwortung eines jeden LSAP-Mitglieds: Jeder kann und soll Gastbeiträge verfassen, die er dann an die Zeitungen weiterleitet. Diese Artikel können dann wiederum auch über die sozialen Netzwerke verteilt („geshared") werden.
Die Partei und die Parlamentsfraktion üben ihren Einfluss in den politischen Dossiers für die Schwächeren in der Gesellschaft aus. Sie betreiben keinen "Etikettenschwindel", sondern werden zumeist ihrem Wählerauftrag gerecht. Aber die breite Öffentlichkeit, sogar viele Parteimitglieder, haben oftmals keine Kenntnis von dieser Arbeit. Das auch, weil die langjährige Regierungspartei LSAP nach außen mehr Pragmatismus und Konsensualismus an den Tag legen muss als eine Oppositionspartei. In einigen wesentlichen politischen Fragen - besonders brisante Fragen, die in den Zuständigkeitsbereich des jeweiligen Koalitionspartners fallen - kennt die Öffentlichkeit die Positionen der LSAP nicht genug.
Die LSAP wirkt mittlerweile oft als eine Partei ohne wirkliche Diskussionskultur nach innen (vgl. z.B. den Ablauf der Kongresse) und gleichzeitig zu konsensorientiert nach außen, zu korrekt oder ängstlich gegenüber ihren Koalitionspartnern. Sie sollte als Partei offensiver sein, und ihre Überzeugungen (zum Beispiel durch den Generalsekretär) der Öffentlichkeit bekannt machen, auch wenn der nachfolgende Regierungskompromiss teilweise anders aussehen mag.
Viele soziale Errungenschaften werden in Luxemburg oftmals als Selbstverständlichkeit angesehen werden, obwohl dies - im Vergleich zum Ausland - oft keineswegs der Fall ist. Man denke nur an die regelmäßige Anpassung des Mindestlohns, die hohen arbeitsrechtlichen Standards in Luxemburg, die regelmäßige Anpassung der Renten, die Einführung einer Mietsubvention, oder als rezente Beispiele die „Wiederherstellung" des Indexmechanismus oder die geplante Mehrheitsbeteiligung der öffentlichen Hand an Enovos. Letztere etwa entspricht der typisch sozialdemokratischen Position einer starken Präsenz des Staates in strategisch bedeutenden Wirtschaftssektoren und -betrieben, von der letztendlich nicht nur die Arbeitnehmer profitieren werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Staaten, die ihre Beteiligungen an Staatsbetrieben im Lauf der Zeit an private Investoren verkauft haben, investiert der Luxemburger Staat auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten weiter in seine Betriebe. Eine durchaus bemerkenswerte Politik, die eine sozialistische Handschrift trägt, die im internationalen Kontext alles andere als selbstverständlich ist und dementsprechend noch stärker in der breiten Öffentlichkeit thematisiert werden soll.
Mögliche Reaktionen im Bereich der politischen Kommunikation seitens der LSAP, besonders seitens der Partei(-leitung), die über mehr Freiheiten verfügt als die Fraktion, sind:
Alle Kommunikation der Partei braucht inhaltliche und formale Kohärenz und Konsistenz um ein stringentes Narrativ herauszuarbeiten.
Die Internet-Seite der LSAP muss unbedingt aktueller und vielfältiger werden. Die verstärkte inhaltliche Präsenz in sozialen Medien ist ein Muss.
Archivierung und Verwaltung von Parteiwissen (Arbeitsdokumente, Parteipositionen) muss gewährleistet werden - ein systematischer Aufbau eines kollektiven Parteigedächtnisses wäre vonnöten.
Fortbildungskurse für Parteimitglieder organisieren (politische Bildung, Rhetorik, Nutzung und Kommunikation in sozialen Netzen, Funktionsweise/Geschichte der Partei...).
Eine Person bestimmen, die die Kommunikation koordiniert. Diese könnte Sektionen unterstützen z.B. bei der Verwaltung einer Homepage, der Konzeption und Realisierung einer Broschüre... Es wäre wichtig für die Sektionen eine „Boîte à outils" zu haben. Mit einfachen Anleitungen wie verschiedene Projekte/Aufgaben angegangen werden können bzw. bei wem sie diesbezüglich Hilfe auf Parteiebene erhalten.
Ausarbeitung von grundlegenden Argumentationsketten oder -hilfen („notes politiques" oder Q&A, Fragen und Antworten, zu spezifischen Themen), konsequentere fachliche Unterstützung der Kandidaten bei Wahlen, gemeinsame Ausarbeitung von zugänglichen Dateien von Presseartikeln und Positionspapieren für Partei und Fraktion. Organisieren von Bildungsseminaren durch die Fondation Robert Krieps.
Der Öffentlichkeit kommunizieren, was die eigene Position zu einem Thema ist; konkret zeigen, dass die LSAP ihren Wählerauftrag wahrnimmt und sich in jedem Dossier für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Die Partei sollte ihre eigene Position bekannt machen, auch wenn am Ende ein Regierungskompromiss mitgetragen werden muss. Die Identität der LSAP soll auf jeden Fall in den Beschlüssen erkennbar sein. Aufgrund der untypischen Luxemburger Demografie und Arbeitsmarktsituation muss das Engagement der LSAP die so genannte Mittelschicht berücksichtigen. Wesentlich ist, dass die hier beschriebene Kommunikationstätigkeit nicht einseitig, etwa von der Parteileitung, erfolgt, sondern einer reellen Strategie folgt, und andere Parteiakteure (Fraktion und Regierungsmitglieder) mit einbezieht.
Ideen der LSAP öffentlich vertreten, auch wenn diese nicht in einem Koalitionsvertrag stehen. Als Beispiel kann die „Reichensteuer", Investitionsfonds, gezielte Armutsbekämpfung, eine aktivere Forschungs- und Kulturpolitik oder die Reform der Erbschaftssteuer gelten. Solche Ideen können von einzelnen Abgeordneten oder auch von der Partei geäußert werden. Sie sollen zeigen, dass Regierungspolitik auf Kompromissen beruht, und nicht gleichzusetzen ist mit den Positionen der LSAP.
Errichtung einer zentralen Agenda (im Internet) für den öffentlichen Auftritt von LSAP-Spitzenpolitikern.
Spezifische Infoblätter für spezifische Wählergruppen: Die Politik der LSAP für Arbeitnehmer, für Jugendliche, für Frauen, für Ausländer etc.
Visibilität in der Zivilgesellschaft stärken (z.B. Asti, Planning Familial). LSAP-Mandatsträger sind nicht (physisch) präsent und daher unsichtbar. Hearings mit verschiedenen Gruppen der Zivilgesellschaft veranstalten um ihr Anliegen besser zu verstehen.
Die Partei und einzelne Abgeordnete sollten sich nicht scheuen, vereinzelt auch kritischere Töne zur Regierungspolitik zu äußern. Auch in einer gut funktionierenden Koalition ist es manchmal sinnvoll und nötig Druck innerhalb der Koalition aufzubauen, ja, manchmal sogar innerhalb der eigenen Partei, um zu einem guten Resultat im Sinne der Bürger und der LSAP zu gelangen. Das natürlich in einem frühen Stadium der Diskussionen, wenn möglich abgestimmt mit anderen Akteuren der Partei, und nur so weit, dass die geäußerten Positionen nicht in einem direkten Widerspruch zum Koalitionsabkommen stehen.
Eine komplette Kommunikationsstrategie zu Papier bringen und umsetzen. Beteiligt werden sollen in diesem Zusammenhang nicht nur die Mitglieder der Parteileitung, politische Amtsträger, oder externe Experten, sondern auch die Personen, die diese Strategie nachher umsetzen sollen, also die Kommunikationsexperten der Partei, der Parlamentsfraktion und die Fondation Robert Krieps.
Monatliche Briefings mit Information über Partei-, Fraktions- und Regierungsarbeit per E-Mail an alle Parteimitglieder - worin die politischen Botschaften und Aktivitäten der LSAP und ihrer Mandatsträger (Gesetzesprojekte, Questions parlemantaires etc.) dargelegt und erklärt werden, mit kurzen, leicht verständlichen Informationen aller Art.
Systematisch Rückmeldungen auf alle Anfragen (ob per Mail oder Brief) geben: dieses Prinzip sollte allgemeine Gültigkeit haben.
Näher an den Mitgliedern sein, d.h. dafür sorgen, dass LSAP-Positionen von den Mitgliedern verstanden werden und so eine „mouth-to-ear"-Kommunikation zwischen Parteimitgliedern und ihren Bekannten in der Gesellschaft funktionieren kann. Politik ist oftmals komplex; es ist von besonderer Bedeutung, den Rückhalt der Mitglieder zu gewinnen, die einen wesentlichen Einflussfaktor in der Gesellschaft darstellen.
„Regionale" Positionen in der Kommunikation mehr zur Kenntnis nehmen und ernst nehmen. Die starke demografische Dominanz des Südens und des Zentrums kann dazu führen, dass Interessen der bevölkerungsschwachen Bezirke des Ostens oder des Nordens nicht erkannt und vertreten werden. Eine Volkspartei muss Lösungen für alle Regionen bereithalten und kommunizieren.
Die LSAP sollte die Möglichkeit in Betracht ziehen einmal im Jahr ein großes Event zu organisieren. Diese Art von Aktivität wird zurzeit nur von lokalen Sektionen wahrgenommen. Beispiele: Donauinselfest der SPÖ oder die 1. Mai-Feier des OGB-L. Die hohe Mitgliederzahl der LSAP sollte gewährleisten, dass genügend „Helfer" für die Organisation des Events zur Verfügung stehen und ein ausreichendes Potenzial an Besuchern besteht.
4. Fazit
Es gibt viel zu tun und jeder Einzelne von uns ist gefordert. Doch viele Sozialisten und Sozialdemokraten glauben nicht mehr an ihre Sache, weil sie ihre klassische Idee des Fortschritts verloren haben. Doch es ist die Aufgabe der Politik, neue Zukunftsvisionen zu benennen und die Menschen für diese zu begeistern. Die LSAP sollte sich darum bemühen, einen neuen und zeitgemäßen Fortschrittsbegriff zu entwickeln. Kriterien eines humanen und sozialdemokratischen Fortschrittsbegriffs sind unter anderem: Teilhabe durch Bildung, vorsorgende Sozialpolitik, um allen gleichermaßen ein autonomes Leben zu ermöglichen, soziale Gerechtigkeit, die dafür sorgt, dass sich die Gesellschaft nicht spaltet, sowie die Tendenz der Ausgrenzung auf den Märkten bekämpft und sozialpolitisch korrigiert wird. Der neue Fortschritt beinhaltet aber auch Gerechtigkeit gegenüber zukünftigen Generationen, er geht mit den natürlichen Ressourcen so um, dass die Menschen, die nach uns leben werden, die gleichen Chancen auf ein gutes Leben haben, wie wir heute. Die politische Vernunft verlangt nach Bedingungen gleicher Freiheit, nach einer inklusiven nationalen und globalen Gesellschaft und sie setzt die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung.
Die LSAP erscheint jedoch oftmals nicht mehr als eine Partei des Fortschritts, sonders als zögerliche, wenig dynamische Partei. Der seit 30 Jahren abnehmende Wähleranteil ist nicht nur „hausgemacht", sondern hängt auch mit der Ausdifferenzierung des Parteiensystems zusammen, mit der langen Regierungszughörigkeit, die eigene Positionen weniger deutlich in der Öffentlichkeit erscheinen lässt, und sicherlich auch mit der spezifischen Wählerstruktur in Luxemburg (hohes Gewicht des öffentlichen Sektors in der nationalen Wählerschaft, ein großer Anteil der Privatbeschäftigten wohnt im Ausland und ist nicht wahlberechtigt). Dazu kommt - ähnlich wie dies von Martin Schulz in der Kampagne zur Europawahl geäußert wurde -, dass die Politik im Allgemeinen, darunter auch die LSAP als Regierungspartei, Probleme auf der Makroebene angeht, und Tendenz hat die Auswirkung auf die "Einzelperson" zu vernachlässigen. Die LSAP muss auch auf dem Terrain wieder viel mehr arbeiten, dieses dann auf der politischen Ebene umsetzen, dabei ihren Prinzipien treu bleiben und erklären, dass es gerade in Zeiten, in denen es nicht viel zu verteilen gibt, darauf ankommt, vor allem das Solidaritätsprinzip zu stärken.
Soziale Demokratie zielt auf gleiche Freiheit und auf die Sicherung ihrer sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Voraussetzungen. Das ist eine dauernde Aufgabe, die je nach den gegebenen Ressourcen und Voraussetzungen in unterschiedlicher Weise und auf unterschiedlichem Niveau erfüllt werden kann. Soziale Rechte setzen voraus, dass jeder Bürger für sein Leben eigenverantwortlich sorgt, soweit er das vermag, und auf eine gesicherte Unterstützung des Gemeinwesens rechnen kann, wo seine eigenen Kräfte nicht ausreichen. Ohne Fundierung in sozialer Gerechtigkeit und ohne Verpflichtung des Staates auf eine am Bürger orientierte Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik bleibt die Demokratie für eine Vielzahl von Bürgern ein bloßes Rumpfgebilde oder Torso. Das Eintreten der sozialdemokratischen Parteien für eine soziale Demokratie ist daher nicht nur ein Erfordernis, um das Leben der Menschen besser und die Gewährleistung ihrer Grundrechte wirksamer zu machen. Es ist auch eine Voraussetzung dafür, dass die Demokratie ihrem Anspruch gerecht werden und auf diese Weise dauerhaft gesichert werden kann.
Die aktuelle parteiinterne Debatte muss im Dialog mit allen Mitgliedern weitergeführt werden und es ist zu hoffen, dass aus den präsentierten Ideen und parteiinternen Diskussionen tatsächlich die nötigen Schlüsse gezogen werden. Bei den drei angesprochenen Themenfeldern sollte die LSAP Prioritäten nenne, zu deren Umsetzung die Parteileitung sich konkret innerhalb eines Jahres verpflichtet:
die Einsetzung einer zielgerichteten und kompetenten Arbeitsgruppe zur Entwicklung von Vorschlägen der LSAP für eine grundlegende und gerechte Steuerreform (Politikgestaltung);
die Reform der Parteileitung, monatliche Briefings mit Information über Partei-, Fraktions- und Regierungsarbeit per E-Mail an alle Parteimitglieder und eine bessere Mitgliederbetreuung, vor allem kurz nach dem Eintritt in die Partei (Parteireform); und
eine bessere Vernetzung der internen und externen Kommunikation („boîte à outils") mit dem besonderen Augenmerk auf ein systematisches Teilnehmen und Verbreiten von Inhalten im Internet und in den sozialen Medien.
Die Sozialdemokratie in Europa befindet sich am Anfang des Wiederaufstiegs. Die Ansätze und Überschriften für eine neue Erzählung mögen noch recht unterschiedlich sein, doch die als zu bearbeiten identifizierten Themen, wie unter anderem soziale Gerechtigkeit, Solidarität, Demokratie oder ein neues sozioökonomisches Paradigma, sind oftmals die gleichen, so auch in Luxemburg. Daher wird es in den kommenden Monaten und Jahren auch darum gehen, die verschiedenen nationalen und internationalen Überlegungen zur Zukunft der Sozialdemokratie zusammenzuführen. Hierbei kann die Fondation Robert Krieps und die europäische Stiftung der Sozialdemokratie (FEPS) wertvolle Hilfe leisten.
Die LSAP muss sich selbst wieder davon überzeugen, dass die Idee einer zukunftsorientierten, sozialen Demokratie, die auch zum Teil gewisse grüne und liberale Ziele einbezieht, im 21. Jahrhundert jedes Potenzial besitzt, Mehrheiten zu überzeugen. Die progressiven Kräfte können nur eine breite Zustimmung in der Gesellschaft finden, wenn die LSAP diese durch eine kohärente und integriert fortschrittliche Gesellschaftsvision bündelt, in Diskussion und Kooperation mit der Zivilgesellschaft, den Gewerkschaften und allen linken, fortschrittlichen, sozialökologischen und linksliberalen Kräften.
Für die Fondation Robert Krieps:
Ben Fayot, Franz Fayot, Marc Limpach und Christophe Schiltz
(unter Berücksichtigung der vielen Diskussionsbeiträge von einzelnen Parteimitgliedern vor und während der Sommerakademie, insbesondere der detaillierten schriftlichen Vorschläge von Paul Delaunois und Marc Thiltgen)
1 Die erste Fassung dieses Papiers wurde mündlich auf der Sommerakademie 2014 der LSAP vorgestellt. Die vorliegende zweite Fassung integriert zusätzlich die Ergebnisse der drei Arbeitsgruppen, die im Rahmen der Sommerakademie getagt haben. Für die vorliegende Analyse und den Inhalt des Papiers trägt jedoch die Fondation Robert Krieps (und nicht die Parteileitung) die alleinige Verantwortung. Aufgabe der Parteileitung wird es sein, Prioritäten festzulegen und umzusetzen.